|
8.
Eine-Welt-Filmpreis
NRW
Zum 8. Mal wird im Rahmen des Fernsehworkshop Entwicklungspolitik der Eine-Welt-Filmpreis
NRW verliehen. Der Preis wird vom Ministerum für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien
des Landes Nordrhein-Westfalen
gestiftet und
ist mit 5.000 €, 3.000 € und 1.500 € dotiert.
1.
Preis: Jakarta Disorder von Ascan Breuer und Victor Jaschke
2.
Preis: Aus meinem syrischen Zimmer von Hazem Alhamwi
3. Preis: AIDS - Erbe der Kolonialzeit von Carl Gierstorfer
Die Jury hat außerdem die Aufgabe, außergewöhnliche
Filme für die Bildungsarbeit zu empfehlen
Mitglieder
der Jury
Burkhard
Althoff, ZDF/Das kleine Fernsehspiel
Lucie Bader, outreach gmbh - Wissenschaftskommunikation und Film, Bern
Thomas Belke, Mediathek
für Pastoral und Religionspädagogik, Freiburg
Bettina Borgfeld, Filmemacherin, Berlin
Jürgen Hammelehle, Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungsdienst,
Berlin
Die
Begründungen
1.
Preis:
Jakarta
Disorder
Ascan
Breuer, Victor Jaschke. Österreich 2013, 87 min.
Begründung
der Jury
:
Dieser
einfühlsame und spannende Dokumentarfilm lässt miterleben, wie am Rande
von Jakarta l ebende
Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem
gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen
sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante
politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in
Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei
faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln
eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5
Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen
Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur
von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt. ebende
Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem
gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen
sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante
politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in
Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei
faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln
eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5
Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen
Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur
von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt.
Jakarta Disorder zeichnet sich durch eine hervorragende Montage
aus, die entscheidend dazu beiträgt, dass ein komplexes Thema
nachvollziehbar, bewegend und doch auch unterhaltsam vermittelt wird. Der
Film lebt von eindrucksvoll in Szene gesetzten Kontrasten: Hier das Modell
des projektierten Luxus-Hochhaus-Wohnparks, dessen Miete selbst für
Gutverdienende nicht bezahlbar erscheint. Dort die einfachsten Behausungen
von Menschen, die im informellen Sektor versuchen, wenigsten kleinste Einkünfte
zu erzielen. Immer wieder sind es die Blicke aus einer „Perspektive am
Rande“ auf die nahe Skyline von Jakarta, die zur Dramaturgie des Films
gelingend beitragen. Hier die oft machtlos erscheinenden Bewohner, die
sich das Recht heraus genommen haben, Land für sich zu beanspruchen, das
ihnen formal nicht gehört. Dort die expansive Macht des Kapitals. In
diesen ausgezeichnet visualisierten Spannungsfeldern lässt der Film die
beiden Protagonistinnen überzeugend auftreten und agieren. Die Kamera
begleitet sie dabei engagiert, lässt Nähe und Sympathie zu ihnen
entstehen, ohne Grenzen zu überschreiten. Zwei in Ihrer Lebensgeschichte
und ihrer gesellschaftlichen Rolle sehr verschiedene Frauen werden zum
Kristallisationspunkt für eine Sozialbewegung. Der Film geht dabei
ehrlich mit den beiden und damit auch den Zuschauenden um: Die
Protagonistinnen werden nicht nur in ihrer erfolgreichen Aktivierung der
Bevölkerung gezeigt, sondern auch in sehr persönlichen Sequenzen, in
denen ihre Motivation und Kraft, aber auch ihre Ratlosigkeit und Zweifel
ins Bild kommen.
Dieser Dokumentarfilm ist über Jakarta hinaus bedeutsam. Er rüttelt auf
und stellt Anfragen. Es geht dabei um Sensibilität für die Verlierer von
Globalisierung weltweit. Wichtig: Handeln statt Klagen ist die Botschaft.
Die Potentiale sozialer Organisation zur Artikulierung elementarer
menschlicher Interessen und deren politische Relevanz werden überzeugend
vermittelt. In Verbindung damit werden Wert und Bedeutung von Demokratie
reflektiert. Jakarta Disorder gelingt dies alles in Form einer
packenden Dokumentation. Sie motiviert über den Film hinaus:
organisiertes Handeln kann augenscheinliche Ohnmacht überwinden.
2.
Preis:
Aus
meinem syrischen Zimmer
Hazem
Alhamwi. Frankreich, Libanon, Deutschland
2014, 70 Min.
Begründung
der Jury:
Hazem
Alhamwi erzählt in seinem Film von der Zerstörung der Menschenwürde.
Und vom Widerstand dagegen.
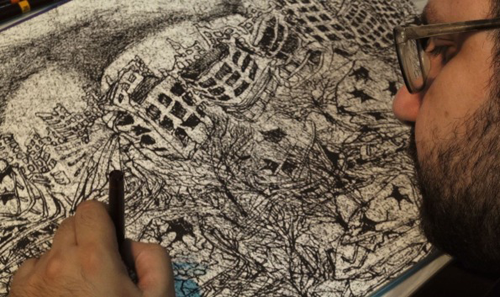 Jahrzehntelang
nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.
Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich
unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von
Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch
indoktriniert und innerlich zerstört. Jahrzehntelang
nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.
Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich
unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von
Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch
indoktriniert und innerlich zerstört.
Hazem
Alhamwi erzählt davon ganz persönlich, erzählt von seinen eigenen Zerstörungen,
von denen seiner Familie. Und mit ihm erzählen Freunde und Verwandte. Es
sind Geschichten von Angst, alltäglichen Niederlagen und Demütigungen,
vom Scheitern, vom Versagen. Keine Heldengeschichten, aber Geschichten,
die zu erzählen heldenhaften Mut erfordert und die man nicht mehr
vergisst.
Aber Hazem Alhamwi erzählt auch vom Überleben. Er selbst überlebte mit
Hilfe seiner Kunst, seiner Zeichnungen, seiner Filme. Dieses kulturelle
Lebenselixier prägt auch dieses dokumentarische Essay. Dessen Form ist
vom Rhythmus, der Wut und Trauer, der Heimlichkeit, dem Irrwitz und der
Kreativität seines dissidenten Schaffens unter ständiger Bedrohung
durchdrungen. Die assoziativen Bilder, der collagenhafte Einsatz von Tönen
und Musik, die bitteren Anekdoten – all das macht in seiner
eindringlich-poetischen Verdichtung das Leben in Unterdrückung
schmerzhaft erfahrbar. Hazem Alhamwi führt die Zuschauer so in die Enge
syrischer Wohnzimmer, Klassenräume und Gefängniszellen. Und er zeigt,
wie diese Enge mit Hilfe der Kunst immer wieder kurz gesprengt werden
konnte.
Aus meinem syrischen Zimmer ist ein berührendes Requiem für die
Generationen von Syrerinnen und Syrern, die sich nicht befreien konnten.
Und doch ist es ein hoffnungsvoller Film. Denn er erzählt auch von der
Generation syrischer Kinder heute. Hazem Alhamwis Hoffnung und dringender
Appell ist es, diese Kinder trotz aller äußeren Zerstörung Syriens vor
ihrer inneren Zerstörung zu bewahren. Ein Appell, der diesem so persönlichen
Film universelle Geltung verleiht. Es ist der Appell, die grundlegendste
und oft gefährdetste Ressource des Menschen - seine Würde – wo immer möglich
zu verteidigen.
3.
Preis:
AIDS -
Erbe der Kolonialzeit
Carl
Gierstorfer. Deutschland 2014, 52 Min,
Begründung
der Jury:
Aids - Erbe
der Kolonialzeit begleitet den belgischen Wissenschaftler Teuwen und
seine Kollegen auf ihrer mehrjährigen Suche nach den Ursprüngen einer
der schlimmsten Pandemien der Menschheit:  HIV/Aids.
Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im
Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können. HIV/Aids.
Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im
Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können.
Während die
meisten seiner Kollegen einen Forschungserfolg auf diesem Gebiet als unmöglich
erachten, gibt Teuwen nicht auf. Die Zuschauenden nehmen Teil an einer
spannenden Suche des Wissenschaftlers, seinen Fragen, den Entdeckungen und
Schlussfolgerungen.
Seine Spur führt zunächst in die belgische und französische
Kolonialzeit und die hemmungslose Ausbeutung ehemaliger Kolonialgebiete
Afrikas. Mit Hilfe von Historikern, Virologen und Biologen rekonstruiert
der Film den Ursprung des Virus beim Affen und den Verlauf seiner
Ausbreitung und legt die Mitverantwortung der Kolonialherren durch ihre rücksichtslose
Ausbeutung an der Entstehung der Pandemie nahe. Der erzählerische Bogen
über das Jahrhundert zu heute entlässt den Zuschauer mit der drängenden
Frage nach gleichem Handlungsmuster - der fortwährenden, nun legalen
Ausbeutung von Rohstoffen in den afrikanischen Ländern durch die
Industrieländer: Bergen die sozialen Folgen der Ausbeutung die Gefahr
neuartiger Viren für Menschen und ihre Ausbreitung, eine Wiederholung des
Ursprungs von HIV/Aids mit einem neuen, andersartigen Erreger?
Interdisziplinär, spannend erzählt und mit klug in Szene gesetztem
Archivmaterial und Grafiken eröffnet „Aids - Erbe der
Kolonialzeit" eine neue, entwicklungspolitische Perspektive auf die
Pandemie, um schließlich die drängenden Fragen nach der Gefahr heutiger
neuer Erreger zu stellen.
Beim Kampf
gegen Infektionskrankheiten muss aus der Vergangenheit gelernt werden. Der
Film ist ein Plädoyer dafür, dass bei auftretenden Krankheiten der
Zukunft früher mit deren Entdeckung und Enttabuisierung begonnen werden
muss. Nur so kann das Leben von Millionen Menschen gerettet werden.
nach
oben
Empfehlungen
für die Bildungsarbeit
La
Buena Vida - Das gute Leben
Jens
Schanze. Deutschland,
Schweiz, Kolumbien 2015, 94 Min.
Begründung
der Jury:
Dieser packende Dokumentarfilm bindet Welten zusammen. Er beginnt in
Deutschland mit der Sprengung eines Bohrturmes. Ende einer Kohlezeche.
Dann geht es nach Kolumbien: „El Cerrejón“  ist
mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:
100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes
kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in
der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine
Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für
sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:
Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt
weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung
bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.
Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären
verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito
eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher
aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:
Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der
Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen
Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle
und anderen Bodenschätzen im Weg stehen. ist
mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:
100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes
kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in
der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine
Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für
sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:
Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt
weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung
bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.
Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären
verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito
eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher
aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:
Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der
Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen
Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle
und anderen Bodenschätzen im Weg stehen.
La Buena Vida setzt vielfältige thematische Impulse, die über den
Film hinaus weisen und sich für Bildungsprozesse anbieten. Globalisierung
wird konkret und exemplarisch erlebbar: Strombedarf in Deutschland im
Kontext der vielzitierten Energiewende - und Entwurzelung von Menschen in
Kolumbien. Wirtschaft, die nicht wirklich auf menschliche Schicksale
schaut. La Buena Vida klagt dabei nicht verbal an, sondern die
Situation der Bewohner von Tamaquito und ihr Widerstand sprechen eine
starke und eindeutige Sprache, die durch eindrucksvolle Bilder einer sehr
guten Kamera getragen wird. Viele kraftvolle Bilder kommen auch ohne Worte
und Kommentierung aus. So gelingt es z.B. allein filmisch zu erzählen,
was den Reichtum des Dorfes Tamaquito ausmacht, worin die hohe
Lebensqualität besteht, welches wirklich die wichtigen Lebens-Ressourcen
sind: Wasser, Früchte und Fische. Diese „heile Welt“ wird durch eine
gute Montage immer wieder kontrastiert: Die neue Urwaldpiste, die nach
Tamaquito führt mit dem nach oben führenden Kameraschwenk, der am
Horizont bereits den drohenden Kohleabbau ins Bild bringt. Oder die pädagogische
und praktische Begleitung der Umsiedlung durch Personen, die keine
Verbindung zur Lebenswelt und Kultur der Bewohner von Tamaquito aufweisen.
Auch dass der zu unterzeichnende Vertrag sogar Weltbank-Standards
beinhaltet, wirkt paradox. Stellvertretend für die zu ertragende
Entwurzelung und Entfremdung kann die Szene gelten, als einige Bewohner
einen ersten Besuch im Retortendorf „Tamaquito 2“ machen: Sie tragen
dabei blaue Plastikhelme der Kohlearbeiter von „El Cerrejón“. Ein
Geschenk, das sie weder benötigen, noch ihnen eine wirksamen Schutz
bietet.
Die
fliegenden Jungen von Gaza
Carmen
Butta. Deutschland
2013,
44
min.
Begründung
der Jury:
Die
Jury ist der Überzeugung, dass dieser Film einen anderen Blick auf die
medial oft vorkommende Region Gaza wirft. Er ermöglicht Einsichten
jenseits des politischen Konflikts. Deshalb ist er eine  sinnvolle
Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit. sinnvolle
Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.
Mit ihren akrobatischen Übungen beim „Parkour" beschreibt er ein
Stück westlicher Jugendkultur, die die Jungs in Gaza als Flucht aus ihren
eigenen kulturellen Zwängen mit Begeisterung betreiben. Nicht nur, dass
sie sich Repressalien ihrer Gesellschaft ausgesetzt sehen, auch innerhalb
des geschickt in Szene gesetzten Familienportraits werden Konflikte
beleuchtet. Daran wird das Dilemma einer Gesellschaft beschrieben, deren
Jugendliche längst über soziale Medien weltweit vernetzt sind und die
sich von den Zwängen ihrer Kultur entfernen wollen. Die Symbolik, die über
den Film vermittelt werden kann, ist stark: die Freiheit zu spüren, indem
man sich über die zerstörten Gebäude seiner eingrenzenden Heimat mit
artistischem Geschick bewegt, kann beim Einsatz in der Bildungsarbeit mit
Jugendlichen durchaus motivierende Funktion haben. Letztendlich regen die
44 spannenden Minuten auch zu der Fragestellung an, ob „Parkour"
den Jugendlichen hilft, sich keiner radikalen Gruppierung anzuschließen
oder ob der Vater gleiches erreicht, in dem er mit seinen Söhnen regelmäßig
eine Moschee mit gemäßigten Predigern besucht.
Durst!
Angela
Andersen, Claus Kleber. Deutschland
2014,
45 min.
Begründung
der Jury:
Überwältigend
schöne Bilder und dramatisches Geschehen erleben wir in der
ZDF-Dokumentation Durst! auf eindrückliche Weise. Kein Wunder,
dass wir gebannt hinschauen, wenn uns Angela  Andersen
und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der
Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst
spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer
werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,
dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser
für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien
gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser
ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film
zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.
Durch immer höhere Konsumansprüche und unglaubliche Verbrauchsvolumen
ist die Versorgung mit Wasser weltumspannend schwieriger geworden. Ob an
den wachsenden Wüstenrändern Chinas, den Gemüseplantagen in Spanien
oder den vergifteten Flüssen Indiens, Claus Kleber befragt Bauern,
Plantagenbesitzer wie auch Wissenschaftler, die massiv von der
Wasserknappheit betroffen sind, nach Ursachen. Der Reporter steht den
Leuten auf Augenhöhe gegenüber und fragt neugierig und interessiert
nach. Durch seine prägnante und eindringliche Kommentierung macht er
deutlich, wie groß die Gefahr des Wassermangels ist. Dabei sind kritische
und appellierende Worte zu vernehmen. Themen wie Gentechnologie,
Entsalzung des Meerwassers oder die grüne Revolution sind Ausgangspunkte
für wirtschafts- und sozialpolitische Überlegungen, die uns in dieser
fesselnden ZDF-Dokumentation dargelegt werden. Es drängt sich bei uns die
Frage nach dem Wirken des individuellen Handelns auf. Die emotionsstarken
Bilder lassen uns verstehen, dass das Menschenrecht auf Wasser bewusst
angegangen und erkämpft werden muss. Die Jury empfiehlt die interessante
Dokumentation für die Bildungsarbeit. Der informative Inhalt, die
packenden Geschichten und die moderne visuelle Filmnarration machen die
Sendung zu einem aufrüttelnden Erlebnis. Andersen
und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der
Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst
spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer
werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,
dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser
für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien
gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser
ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film
zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.
Durch immer höhere Konsumansprüche und unglaubliche Verbrauchsvolumen
ist die Versorgung mit Wasser weltumspannend schwieriger geworden. Ob an
den wachsenden Wüstenrändern Chinas, den Gemüseplantagen in Spanien
oder den vergifteten Flüssen Indiens, Claus Kleber befragt Bauern,
Plantagenbesitzer wie auch Wissenschaftler, die massiv von der
Wasserknappheit betroffen sind, nach Ursachen. Der Reporter steht den
Leuten auf Augenhöhe gegenüber und fragt neugierig und interessiert
nach. Durch seine prägnante und eindringliche Kommentierung macht er
deutlich, wie groß die Gefahr des Wassermangels ist. Dabei sind kritische
und appellierende Worte zu vernehmen. Themen wie Gentechnologie,
Entsalzung des Meerwassers oder die grüne Revolution sind Ausgangspunkte
für wirtschafts- und sozialpolitische Überlegungen, die uns in dieser
fesselnden ZDF-Dokumentation dargelegt werden. Es drängt sich bei uns die
Frage nach dem Wirken des individuellen Handelns auf. Die emotionsstarken
Bilder lassen uns verstehen, dass das Menschenrecht auf Wasser bewusst
angegangen und erkämpft werden muss. Die Jury empfiehlt die interessante
Dokumentation für die Bildungsarbeit. Der informative Inhalt, die
packenden Geschichten und die moderne visuelle Filmnarration machen die
Sendung zu einem aufrüttelnden Erlebnis.
nach
oben
|
 ebende
Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem
gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen
sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante
politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in
Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei
faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln
eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5
Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen
Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur
von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt.
ebende
Slum-Bewohner ihren Widerstand organisieren, als ihre Behausungen einem
gigantischen Immobilien-Bauvorhaben internationaler Investoren weichen
sollen. Aus zunächst offensichtlicher Ohnmacht wird eine relevante
politische Stimme von Ausgegrenzten, die auf die noch junge Demokratie in
Indonesien wirksam Einfluss nimmt. Im Zentrum dieser Bewegung stehen zwei
faszinierende Protagonistinnen, deren Überzeugung und Handeln
eindringlich und überzeugend vermittelt wird. Letztlich sind es 1,5
Millionen Unterschriften der verarmten Bevölkerung, die einem politischen
Forderungskatalog so viel Gewicht verleihen, dass sich der neue Gouverneur
von Jakarta von diesem in die Pflicht nehmen lässt.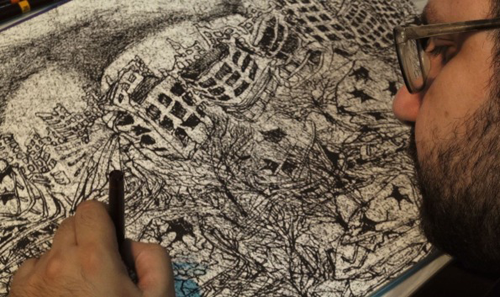 Jahrzehntelang
nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.
Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich
unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von
Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch
indoktriniert und innerlich zerstört.
Jahrzehntelang
nahm das syrische Regime seinen Bürgern brutal alle grundlegenden Rechte.
Es war unmöglich sich frei zu äußern, politisch zu engagieren, sich
unabhängig zu bilden oder künstlerisch zu entfalten. Generationen von
Syrerinnen und Syrern wurden von Kindesbeinen an systematisch
indoktriniert und innerlich zerstört.  HIV/Aids.
Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im
Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können.
HIV/Aids.
Der Wissenschaftler hofft, Erkenntnisse über die Herkunft von HIV/Aids im
Kampf gegen die Ausbreitung neuartiger Viren nutzen zu können. ist
mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:
100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes
kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in
der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine
Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für
sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:
Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt
weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung
bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.
Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären
verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito
eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher
aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:
Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der
Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen
Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle
und anderen Bodenschätzen im Weg stehen.
ist
mit mehr als 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt:
100.000 Tonnen am Tag als Ertrag. Das Gigantische dieses Projektes
kontrastiert mit dem Urwalddorf Tamaquito mit seinen 30 Familien ganz in
der Nähe der riesigen Maschinen. Den Bewohnern von Tamaquito steht eine
Umsiedlung bevor. Bisher hatten sie alles für ihr Leben. Kohle spielte für
sie keine Rolle. Widerstand und zähe Verhandlungen kommen. Letztlich:
Ausgehandelte Umsiedlung, fremd im eigenen Land am neuen Ort. Der Film führt
weiter: Kohle wird exportiert und kommt in Rotterdam an. Stromerzeugung
bei uns mit Kohle aus Kolumbien. Acht neu eröffnete Kohlekraftwerke.
Besser als Atomkraft!? Internationale Konzerne, die sich ihren Aktionären
verpflichtet sehen. Der Versammlung der Aktionäre ist Tamaquito
eigentlich keine Notiz wert. Auch wenn Jairo Fuentes, der Ortsvorsteher
aus Kolumbien, dort einen eindrucksvollen Auftritt hat und Klage erhebt:
Abmachungen wurden nicht eingehalten: Wasser fehlt. Kein Einzelfall - der
Abspann zeigt es: 30 Familien in Kolumbien stehen für 1,5 Millionen
Menschen, die jährlich umgesiedelt werden, weil sie dem Abbau von Kohle
und anderen Bodenschätzen im Weg stehen. sinnvolle
Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.
sinnvolle
Ergänzung für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit.  Andersen
und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der
Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst
spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer
werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,
dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser
für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien
gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser
ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film
zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.
Andersen
und Claus Kleber auf ihrer filmischen Reise zu Brennpunkten der
Wasserknappheit auf verschiedene Kontinente mitnehmen. Die äußerst
spannende Reportage macht deutlich, dass Wasser weltweit ein immer größer
werdendes Problem ist. Spätestens wenn wir in der Dokumentation hören,
dass in Deutschland jährlich 80.000 Milliarden Liter (!!) fremdes Wasser
für den Konsum beispielsweise von Steaks aus Südamerika oder Jeans aus Südostasien
gebraucht wird, wissen wir, dass uns der Wassermangel etwas angeht. Wasser
ist in der globalisierten Welt zum globalen Problem geworden. Der Film
zeigt auf, welche Gründe es dafür gibt und wie sie sich darstellen.